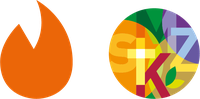Im Rahmen meines Theologiestudiums vor Jahren war ich verpflichtet, zumindest einmal an Exerzitien teilzunehmen. Ich habe das so weit wie nur irgendwie möglich hinausgeschoben, denn ich habe mich nie für einen besonders spirituellen Menschen gehalten. Exerzitien, also geistliche Übungen, die wesentlich von Gebet, Meditation und Besinnung bestimmt sind, schienen mir wenig passend und eventuell sogar zu herausfordernd für mich zu sein. Ich sei doch ein recht »verkopfter«, nüchterner und vernunftorientierter Mensch, dachte ich mir. Was sollte ich da bei Exerzitien, wo ich vielleicht noch in Gemeinschaft anderer beten sollte. Außerdem: Ist Beten nicht Privatsache?
Nicht, dass mir das Gebet fremd war oder ich es gar ablehnte. Ich fühlte mich ihm als junger Mensch nur irgendwie »entwachsen«. Natürlich habe ich als Kind in meiner Familie das Beten erlebt und gelernt. Wie bei vielen anderen religiösen Familien war auch bei uns das Mittagsgebet selbstverständlich. Auch als leidenschaftlicher Ministrant war ich mit dem Beten und der metaphorischen Gebetssprache aus den Gottesdiensten vertraut. Besonders geprägt haben mich aber meine Großeltern, was mir erst so richtig bewusst wird, da ich nun diese Zeilen schreibe. Oft bin ich als Kind bei ihnen über Nacht geblieben. Vor dem Einschlafen ist dann mein Opa oder meine Oma gekommen, hat sich neben mich auf den Diwan gesetzt und gemeinsam haben wir begonnen: »Heiliger Schutzengel mein, lass mich dir empfohlen sein …« oder: »Müde bin ich, geh zur Ruh …«. Ich habe in kindlicher Sprache für den Tag gedankt und mein »Gewissen erforscht«, wie Opa mit bedeutungsschwangeren Worten meinte. Nicht selten habe ich da im Dunkeln noch alleine weiter darüber nachgedacht, was an dem Tag gut und was weniger gelungen war. Irgendwann bin ich wohl bei den Gedanken über Gott und die Welt eingeschlafen. Daran erinnere ich mich gut.
Ich muss gestehen, als Jugendlicher ist mir das Beten etwas abhandengekommen. Was ich als Kind dabei erlebt und mit Worten gesagt habe, ist mir als junger Mensch zu naiv, ja regelrecht banal vorgekommen. Was soll ein mächtiger Gott sich schon anrühren lassen von so kleinlichen Sorgen wie einer Englischschularbeit oder auch großen Anliegen wie dem romantischen Wunsch nach Frieden in der Welt, dachte ich. Und so habe ich es hinter mir gelassen. Nicht dass ich nicht mehr gläubig gewesen wäre oder gar Gott zürnte, wie es so schön heißt. Nein, Beten war einfach nichts mehr für mich. Es schien mir unvernünftig und ich war zu erwachsen dafür. Mein Kopf sagte, das brauche ich nicht.
Geht man aber durchs Leben, erfährt man auch als junger Mensch recht bald und manchmal auch einigermaßen schmerzhaft, dass man doch nicht so souverän ist, wie man glaubt. Es braucht dabei gar nicht große Schicksalsschläge oder Wunder biblischen Ausmaßes, um als halbwegs aufmerksamer Mensch zu erkennen, dass man nicht alles alleine schaffen oder ertragen kann. Gar zu oft ringt man dann nach Worten, weil einem das Leben zu unerträglich und hoffnungslos vorkommt, oder weil es zu überwältigend und wundersam ist, dass es einem regelrecht die Sprache verschlägt.
Im Gebet haben wir Menschen für all diese Momente eine Sprache gefunden. Es ist wohl allen Religionen gemein, dass sie darin besondere Worte für so urmenschliche Erfahrungen wie Leid, Not, Verzweiflung, aber auch Freude, Staunen und Dankbarkeit formulieren können. Man könnte sogar sagen, das Gebet ist eine universale Menschheitssprache für das Besondere, was das Leben für uns bereithält. Manchmal bleibt uns sogar nur mehr das Gebet, weil alles andere zu versagen scheint.
Und so darf ich als Christ auf vorformulierte Gebete wie z.B. das Vaterunser zurückgreifen, wenn ich nach Worten ringe, wenn mir Verzweiflung die Kehle zuschnürt. Dann bin ich wie ein schutzsuchendes Kind, das einen sorgenden Vater hat. Wie gut tut es auch, mit den Psalmen in Stunden des Zweifels zu fragen »Was ist der Mensch…?« (Ps 8,5) oder seinem Ärger Ausdruck zu verleihen, wenn man sich von allem und allen verlassen fühlt: »Verschaff mir Recht Gott … Warum hast du mich verstoßen?« (Ps 43,1-2). Bei diesen Worten weiß ich mich auch über die Jahrhunderte und den Erdkreis hinweg mit allen Menschen vereint, die von denselben Gefühlen bewegt waren oder sind.
Gleichzeitig bietet mir das Gebet auch die Möglichkeit eigenständig und spontan eine Sprache dafür zu finden, was ich an meinen Gott adressieren möchte. Häufig bin ich überrascht, was ich da gerade sage, und ich bin mir dann nicht sicher, ob ich noch nachdenke oder schon zu Gott bete.
Und damit sind wir wohl beim entscheidenden Punkt:
Im Gebet gebe ich meinen Gefühlen, Gedanken und Sorgen eine ganz bestimmte Richtung. Ich stelle geradezu mein Leben unter die Hand Gottes und beziehe mich und mein Sein auf ihn hin. Ich gehe eine Beziehung mit ihm ein. Nicht belanglos sind unsere Worte und nicht irgendwohin ins Nebulöse richten wir sie. Nein, Ziel unseres Sprechens ist immer Gott, denn wir dürfen vertrauen, von ihm verstanden zu werden.
Wie das mit meinen Exerzitien weitergegangen ist?
Nun, tatsächlich war es eine schöne Woche, die für mich und meinen Glauben sehr wertvoll war. Vor allem habe ich in diesen Tagen des Betens, Meditierens und Nachdenkens erkannt, dass mir derartiges Sprechen doch überraschend guttut und dass wir alle unsere je eigene und persönliche Form des Betens über die Jahre hinweg finden müssen und dürfen. Aber unser gläubiges Sprechen braucht eine Richtung, ein Ziel. Und dieses ist für mich Gott. Das scheint mir vernünftig. Auch als »verkopfter« Mensch brauche ich daher das Gebet.
Text: Raimund Stadlmann
Bild: © AdobeStock_135708803.jpeg