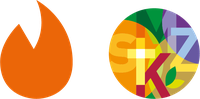Seit kurzem stößt man in ORF und ausgewählten Zeitungen immer wieder auf die Studie »Was glaubt Österreich?«, die sich mit der Religiosität in unserem Land beschäftigt. Für das vom Zukunftsfonds der Republik Österreich geförderte Projekt von ORF und Universität Wien wurden Menschen unterschiedlichen Alters und aus allen Gesellschaftsschichten zu ihrer Religiosität befragt. Von unserem Pfarrverbandsmagazin hatten wir die Gelegenheit, mit einer der beiden Studienleiterinnen, der Religionswissenschaftlerin Astrid Mattes-Zippenfenig (siehe 2. Bild), zu reden. Von dem interessanten Gespräch über die Studienergebnisse haben wir das Wichtigste für Sie hier zusammengefasst. (Details unter https://wasglaubtoe.univie.ac.at)
Diffus aber freundlich
So haben wir erfahren, dass sich etwa zwei Drittel der Menschen in Österreich als »religiös« bezeichnen, wobei der Begriff sehr unterschiedlich verstanden wird. Während die einen ihn über Glaubensinhalte definieren, so sind anderen formale Aspekte wichtig.
Dritte wiederum verbinden Religion mit ihrer Identität. Grundsätzlich lässt sich aber laut Mattes sagen, dass die »gelebte religiöse Praxis in allen Religionen und Glaubensgemeinschaften ein Minderheitenprogramm« sei. Hier bestätigt sich also, wie sehr ein traditionell geprägtes Glaubensverständnis einem Auflösungsprozess unterworfen ist und - in unserem Fall - Kirche an Bedeutung verliert. Ein ähnlich diffuses Bild ergibt sich beim Glauben an Gott, an dessen Existenz nur 22 % der Befragten glauben. 36 % glauben an ein nicht genauer definierbares »höheres Wesen«, während 15 % unsicher sind, woran sie überhaupt glauben. Eine völlige Ablehnung Gottes oder einer transzendenten Wirklichkeit kommt von 22 %. Dennoch zeigt sich, dass die Menschen in Österreich religionsfreundlich eingestellt sind, denn über zwei Drittel meinen, Religionen würden wichtige Werte vermitteln.
Die teils unklaren und widersprüchlichen Glaubens- und Gottesvorstellungen erklärt sich Astrid Mattes u.a. mit unserer liberalen Gesellschaft. Diese sei einerseits aufgrund des hohen Maßes an Freiheit und Sicherheit natürlich äußerst positiv, andererseits ermöglicht sie leicht den Ausstieg aus Gemeinschaften. Einfach gesagt: Wenn mir in einer Gemeinschaft, einer Gruppe oder der Kirche etwas nicht zusagt, dann geh ich eben nicht mehr hin. Religiös bleibe man ja trotzdem, halt auf die je eigene Weise. »Dieser individuelle Zuschnitt ist heute überall möglich, also nehmen das die Leute logischerweise auch in ihrem religiösen Alltag in Anspruch«, sagt die Religionswissenschafterin. Dieses Phänomen stehe auch in Zusammenhang mit einem modernen »neoliberalen Nützlichkeitsdenken«.
Nach diesem leben heute Menschen ihren Glauben zunehmend hinsichtlich eines Nutzens für ihr Dasein aus. So greift man gerne auf die verschiedensten Elemente und Praktiken auch von mehreren Religionen zurück, »wenn‘s mir etwas bringt«. Fernöstliche Meditationstechniken, esoterische Praktiken und christliches Gedankengut lassen sich dann leicht miteinander verbinden. Auffallend, so Mattes, sei aber die ungebrochene Beliebtheit des Gebets, auch wenn darunter heute sehr viel zu verstehen sei.
Herausfordernd seien all diese Entwicklungen für die traditionellen Gemeinschaften wie die katholische Kirche dann, wenn in Zeiten hoher Austritte die Zahl moderat Glaubender immer geringer wird, denn dies führe schnell zu einer Engführung und einer konservativen Elite, die sich abschottet. Dies kann nicht Ziel von Kirche sein. Oder wie Mattes fragt: »Was ist mit dem dazwischen? Wer ist für die in der Mitte noch da?«
Religiös suchende Jugend?
Ein spannendes, doch unerwartetes Ergebnis hat die Altersgruppe der 14 – 25-Jährigen zutage gefördert.
Hier glauben nämlich 30 % an Gott oder eine göttliche Wirklichkeit, weitere 30 % an ein höheres Wesen. Das sind bei diesen Fragen Spitzenwerte über alle Altersgruppen hinweg und somit gegenläufige Tendenzen zum Rest. Zwar finden sich auch hier diffuse und widersprüchliche Meinungen, dennoch zeigt sich die Jugend auffallend neugierig, offen und interessiert an Glaubens- und Sinnfragen. Die Ergebnisse erklären die Studienautor*innen u.a. damit, dass sich heutige Jugendliche nicht mehr an traditionellen Gottes- und Kirchenbildern abarbeiten müssten wie die Generation davor. So könnten sie sich offener und unbelasteter den Themen Glauben, Gott und Religion
nähern. Daraus lasse sich eindeutig eine Aufforderung für uns als Kirche ableiten, bemüht und verantwortungsvoll in den Dialog mit jungen Menschen zu gehen und einen Raum für ihr religiöses Bedürfnis anzubieten.
Antisemitismus und Islamfeindlichkeit wächst
Ein beunruhigendes Bild zeichnet die Studie, wenn sie in Österreich wachsende Ablehnung von Judentum und Islam feststellt. So verneinen etwa 46 %, dass man aus den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs heraus eine besondere moralische Verpflichtung gegenüber Juden habe. Auch das antisemitische Klischee, Juden hätten wachsenden Einfluss in internationaler Politik und Wirtschaft, hat in den letzten Jahren wieder deutlich zugenommen (32 %). Was den Islam angeht, so meint sogar jede(r) Vierte(r), Muslime sollten nicht die gleichen Rechte wie andere Staatsbürger haben.
Diese Daten sind alarmierend, denn historisch gesehen folgen dem Antisemitismus stets Feindseligkeiten gegenüber anderen Minderheiten. Auch verwirrt, dass als Grund für die antisemitischen & antimuslimischen Ansichten oft genannt wird, Österreich sei christlich und müsse christlich bleiben. Die Umfrage belegt aber Gegenteiliges.
Allgemein verdeutlicht die Studie jene Veränderungen, die alle Religionen deutlich spüren, nämlich die Abkehr von traditionellen Vorstellungen hin zu unbestimmteren und individuelleren Formen. Die Einladung, sich mit den Ergebnissen zu beschäftigen, gilt uns allen.
Text: Raimund Stadlmann
Bild 1: © AdobeStock_218462295.jpeg
Bild 2: © Klaus Pichler