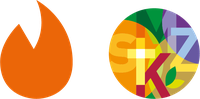Da hörte ich dasselbe Fieber in allen, ein seltsames Tönen und Wirresein in den Stimmen und Haltungen aller Anwesenden. Als sei ihnen ausgelöscht die Erinnerung, wer sie seien, wer sie waren, je sein könnten. Und gebrochen alle Erwartungen an sich selbst.
Diese Worte spricht der Apostel Thomas im Roman Corpus Christi des deutschen Schriftstellers Patrick Roth (veröff. 1999), in dem sich der Apostel auf die Suche nach dem Auferstandenen macht. Thomas, der so schwer an die Auferstehung glauben kann, beschreibt hier in eindrucksvoller Sprache die Sorgen und auch Zweifel der Jünger in der Stunde der österlichen Begegnung mit Jesus. Es ist eine Stimmung der Unsicherheit, von der wir hier lesen. Die Apostel wirken ängstlich, verwirrt und orientierungslos, als hätte sie ein Fieber befallen und wüssten nicht, wie sie nach vorne schauen könnten. Hier ist der Moment der Verzweiflung beschrieben, wie ihn die Frauen zuvor erlebt haben, als sie den verstorbenen Jesus salben wollten, ihn aber nicht fanden. Doch blicken die Apostel nicht in die Finsternis des leeren Grabes, sondern in die Dunkelheit und scheinbare Sinnlosigkeit der Zukunft. Die Szenerie wirkt, als riefen die Apostel in stummer Verzweiflung »Wie geht‘s weiter?«. Sie sind in einem Zustand der Schwebe, denn alle Gewissheit der letzten Jahre hat sich am Kreuz von Golgotha zerschlagen und die neue Zukunft liegt als große Herausforderung vor ihnen. Wer mag es ihnen verdenken, dass sie verzweifelt sind und nach Jesu Tod sogar ihre Identität zu verlieren drohen.
Als Grund für die Verzweiflung nennt der Roman die Empfindung der Apostel, als »sei ihnen ausgelöscht die Erinnerung«. Ihre Angst rührt also in einer Selbstvergessenheit und daher, dass sich die Jünger nicht erinnern, »wer sie seien, wer sie waren und je sein könnten.« Aber wer sind sie denn? Woran sollen sie sich denn da konkret erinnern? Diese Fragen richten sich auch an uns.
Das Lukasevangelium, das wir auch an den Osterfeiertagen lesen, beantwortet die Frage nach der Erinnerung, denn dort hören die Frauen am leeren Grab folgende Worte: »Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war.« (Lk 24, 6) Und so denken die Frauen zurück an Jesu Worte und Taten, an seine Predigten und Wunder. Kraft dieser Erinnerung können sie die Dunkelheit des Grabes hinter sich lassen, an die Auferstehung Jesu glauben und positiv nach vorne schauen. Auch in den beiden Texten danach, in der Emmausgeschichte (Lk 24,13-35) und in der Erscheinung Jesu in Jerusalem (Lk 24,36-49), spielt diese erinnernde Rückschau eine Rolle, wenn Jesus auf die Propheten, die Psalmen und das Gesetz Mose verweist und er damit in die lange jüdische Erzähltradition gestellt wird. Der Evangelist spannt hier aber auch einen Bogen zum Beginn seiner Frohbotschaft, die als aufgezeichnete Erinnerung an Jesu Wirken für die »Zuverlässigkeit der Lehre« steht.
Was der Evangelist Lukas hier schreibt, ist aber weit mehr als eine erinnernde Erzählung. Es ist eine Vision einer neuen Heilszeit, die in Jesu Tod und Auferstehung ihren Dreh- und Angelpunkt hat. Und so folgt nach dem Evangelium, das mit der Auferstehung endet, die Apostelgeschichte als zweiter Teil des Doppelwerks des Lukas. Hier können wir von der Anfangszeit der Kirche lesen und immer wieder wird darin auch von Herausforderungen, Unsicherheiten und Neuorientierung berichtet, denn die jungen Christengemeinden standen oft vor der Frage: »Wie geht’s weiter?« Antworten darauf haben sie auch in der Erinnerung an Jesu Predigt und Werke gefunden, die ihnen Glauben und Kraft gespendet haben und in denen sie Wege für das Gelingen des persönlichen wie gemeinschaftlichen Lebens gefunden haben. Der Rückgriff auf Jesu Rede vom Reich Gottes blieb so nicht bloße Vision, sondern hat eine realitätsverändernde Kraft entwickelt und sich in diesen ersten Gemeinden verwirklicht.
Heute macht es oft den Eindruck, wir lebten in einer Zeit, die arm an Visionen ist. Die großen Versprechungen der Moderne scheinen sich aufzulösen oder zumindest an Kraft zu verlieren. Wer glaubt denn noch an Wohlstand für alle durch Globalisierung, an eine gesunde Welt durch moderne Technologien, an mehr Demokratie dank moderner Medien und Frieden für alle Menschen kraft politischer Zusammenschlüsse vieler Länder. Haben wir hier nicht schon alle Hoffnung verloren? Und wie steht es um unsere Kirche, die immer wieder von Skandalen gebeutelt wird, die sich mit Modernisierung und Demokratisierung so schwertut, die zumindest in unseren Breiten Gläubige verliert und der Jugend immer weniger zur Heimat wird? Hat sie noch eine verständliche Sprache für das befreiende Potential der Auferstehungshoffnung?
Wenn diese Hoffnung auf Auferstehung, auf Befreiung aus den Dunkelheiten unseres Lebens nicht nur theoretische Vision bleiben, sondern Wirklichkeit werden soll, dann sind auch wir gefragt, daran mitzuarbeiten. Dann liegt nämlich in dieser österlichen Vision im Gegensatz zu vielen anderen Versprechungen der Menschheitsgeschichte tatsächlich eine weltverändernde Kraft, die Frieden, Glück und Würde für alle Menschen – für dich und mich – bringen kann. Von dieser Hoffnung, die trägt, hat Jesus in seinen Gleichnissen gesprochen und er hat uns in seinen Wundern und seinem Wirken einen Weg gezeigt, wie das im Hier und Jetzt klappen kann. Es mag dunkle Stunden der Todesangst in unserem Leben geben, Momente der Unsicherheit und des Zweifels. So ist es auch den Frauen am Grab gegangen, den Emmausjüngern sowie Thomas und den anderen Jüngern, als sie nicht wussten, ob es für sie eine Zukunft gibt und wie sie an den Auferstandenen glauben sollten!
Wie‘s geht? Hören wir hin und erinnern wir uns … die Hoffnung sagt: weiter!
Text: Raimund Stadlmann
Bild: © AdobeStock_477283287.jpeg